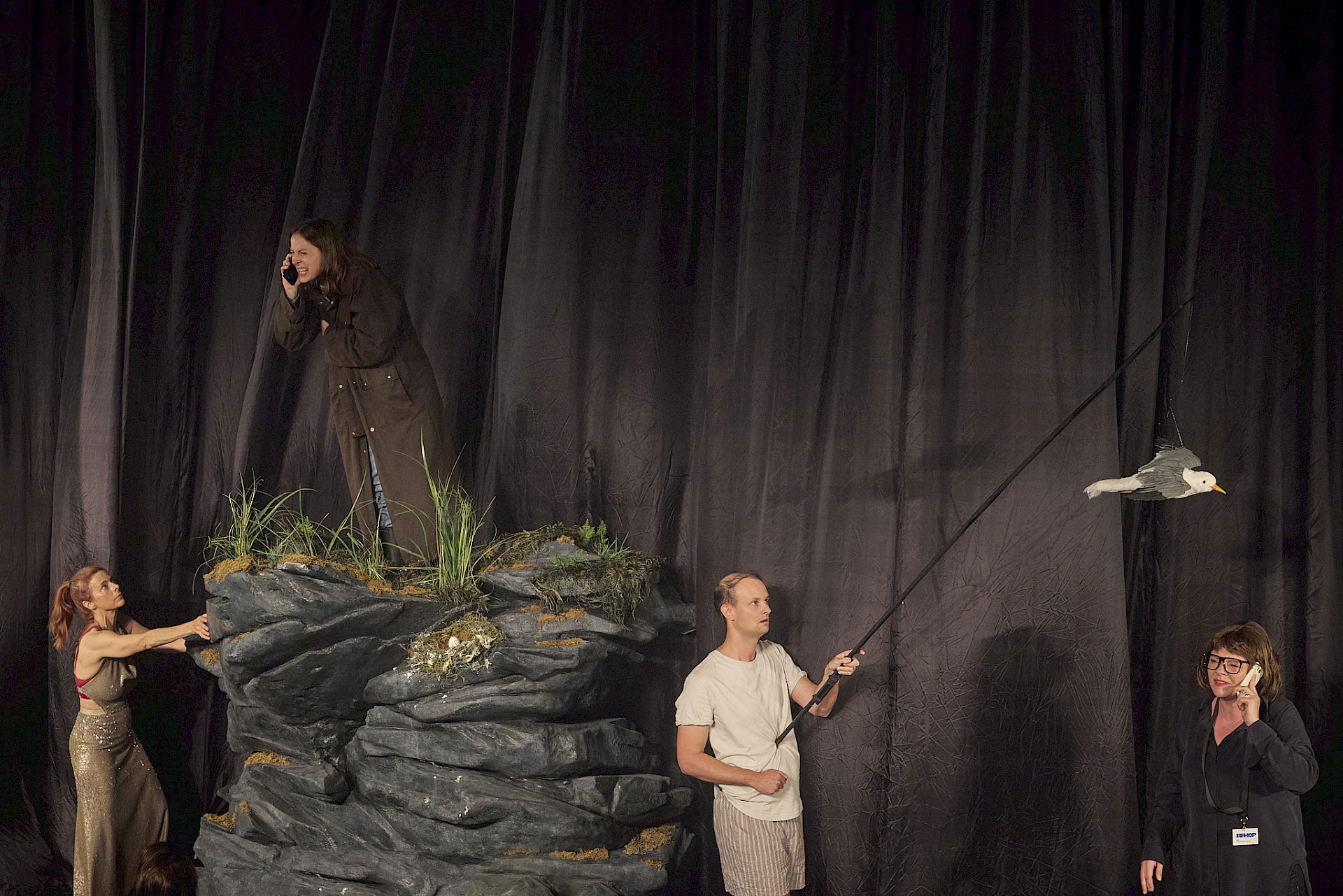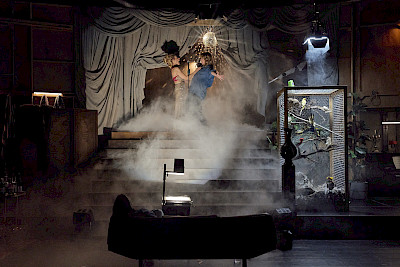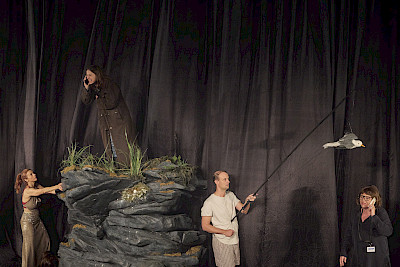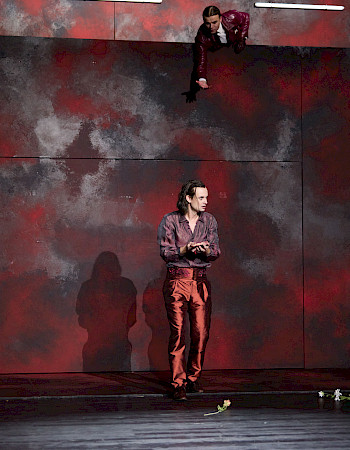Lyonesse – ein feministischer (Alb-)traum?
von Krystian Podwórny
Eine sturmumtoste Villa an der Küste Cornwalls, ein legendärer Name, der nach versunkenen Welten klingt: Lyonesse. Der Titel von Penelope Skinners Stück verweist auf das mythische Land, das laut britischer Sage vor der Küste Cornwalls im Meer versank. Es soll der Geburtsort des Ritters Tristan, Held der Erzählung Tristan und Isolde sein, und damit ein traditionell männlich besetzter Mythos. Wie der Dichter Thomas Hardy in seinem Gedicht When I Set Out for Lyonnesse nahelegt, ist es ein mythischer Ort des Aufbruchs, an dem potentiell alles möglich ist, aber niemand sicher sein kann, welche Sehnsüchte wirklich in Erfüllung gehen.
Hierher flüchtet Elaine nach den Morddrohungen ihres Geliebten und gewinnt, wenn auch mit schmerzhaften Verlusten, ihre Freiheit zurück. In dieser Atmosphäre fühlt sich auch Kate aufgehoben und befreit von gesellschaftlichen Erwartungen. Hier kann sie sich einen Moment von der Überforderung und dem Sich-Aufreiben zwischen den Wünschen ihrer Chefin, den Bedürfnissen ihrer Tochter und den Forderungen ihres Ehemannes befreien. Die alte, baufällige Villa könnte Geburtsort einer neuen Gesellschaft werden, an dem Freiheit und Gleichberechtigung herrschen, sowie bisher vertane Chancen und Potentiale endlich gelebt werden können. Doch kann «Lyonesse» dauerhaft von einem Ort vergangener Männlichkeit zu einem Ort weiblicher Selbstermächtigung umgedeutet werden? Inwiefern klingt darin auch das Brüllen einer starken Löwin an (engl. «lioness»), die endlich die Held*innenrolle in einer neuen Gesellschaft übernehmen kann?
Penelope Skinner ist bekannt für ihre Auseinandersetzung mit Frauenbiografien und gesellschaftlich geprägten Verhaltensmustern – «weiblichen» wie auch «männlichen». Bereits der Name von Sues Filmproduktionsfirma «Lilith» deutet auf zwei Entwürfe von Frauenleben hin: Anders als die biblische Eva ist Adams erste Frau Lilith aus den apokryphen Schriften Adam ebenbürtig und erkennt ihn nicht als ihren Beherrscher an, was zu Streit und Liliths Flucht sowie Verdammung führt. Vor diesem Hintergrund fragt Skinner mit ihren Protagonistinnen auch danach, was Selbstbestimmung heute kostet und wessen Geschichte überhaupt erzählt wird. Fein verwoben eröffnet die Dramatikerin verschiedene Perspektiven auf Elaines Leben und lässt uns den Kampf um die Deutungs- und Gestaltungshoheit der eigenen Geschichte direkt erfahren. Elaine erzählt über die Beziehung zu einem berühmten Regisseur und wie sie sich vor seinen Freunden für die Trennung rechtfertigen muss: «Ich versuche, die Umstände unserer Trennung zu erklären, aber seine Version der Ereignisse hat sich schon in ihren Köpfen festgesetzt.»
Der Satz richtet sich als offene Frage auch an uns: Welche Version der Geschichte setzt sich in unseren Köpfen fest? Wem glauben wir? Und warum? Mit wem haben wir Mitleid? Diese Fragen betreffen letztlich nicht nur Elaines Vergangenheit, sondern auch unsere Wahrnehmung der Beziehung zwischen Kate und ihrem Ehemann Greg.
Die intensive Beschäftigung mit Frauenbiografien ist Skinners Text zudem durch Gedichtzitate eingeschrieben. Immer wieder lassen Elaine und ihre Nachbarin Chris Gedichte von Mary Oliver, Stevie Smith und Silvia Plath anklingen. Diese intertextuellen Verweise wirken doppelt: Einerseits durch ihre poetische Kraft, andererseits durch die dahinterstehenden Biografien der Autorinnen. Mary Oliver lebte beispielsweise jahrzehntelang und bis zu deren Tod selbstbewusst mit ihrer Partnerin, der Fotografin Molly Malone Cook, zusammen. Stevie Smith beeindruckt wiederum mit ihren Werken, die sich klaren Zuordnungen entziehen und wie Skinners Stück zwischen Humor und Abgrund oszillieren. Mit Silvia Plath rückt schliesslich eine Autorin in den Fokus, deren Leben nach ihrem Suizid sensationslüstern ausgeschlachtet wurde. Mal wurde sie als Opfer, mal als rachsüchtige Furie stilisiert, wobei sowohl aus ihrer Perspektive als auch aus der ihres Ehemannes Ted Hughes erzählt wurde. Dabei bleibt stets die für #MeToo zentrale Frage im Raum: Wem glauben wir? Und warum?
«When I came back from Lyonnesse | With magic in my eyes!» – mit diesen Zeilen aus Thomas Hardys Gedicht überträgt Chris die vom legendären Land des Sir Tristan ausgehende Faszination auf die Begegnung der drei Frauen in Elaines Villa. Der männliche Mythos scheint, wenn Chris die Worte spricht, tatsächlich in einen feministischen Traum umgedeutet werden zu können. «Lyonesse» erscheint als ein Ort grenzenloser Möglichkeiten – ein Raum, in dem das Leben nach dem eigenen Willen gestaltet werden kann. Die britische Journalistin Laurie Penny macht aber darauf aufmerksam, dass die Frage danach, was Frauen* im Leben wollen, kompliziert ist: «Ich weiss, tief in mir, dass ich frei und unabhängig sein will. Aber ich will auch schön sein und einen Freund haben und es meinen Eltern recht machen und tun, was in den Zeitschriften steht. Woher weiss ich, ob ich das, was ich will, wirklich will? Und was sollte ich wollen?», zitiert Penny eine Studentin. Dem scheinbar einfachen «Was will ich?» drängt sich sofort ein normativ geprägtes «Was sollte ich wollen?» auf, von dem es schwer ist, sich zu befreien: So stellt sich der Ort der Begegnung und der unbegrenzten Möglichkeiten als fragil heraus: Elaines Haus droht vom Meer verschluckt zu werden. Spätestens als Greg auftaucht und in den vermeintlich geschützten Raum eindringt, weicht der feministische Traum einer eisigen Realität: «No use whistling for Lyonnesse! | Sea-cold, sea-cold it certainly is», schreibt Sylvia Plath in ihrem Gedicht Lyonnesse. Was bei Hardy noch mit «Magie in den Augen» endet, schlägt hier in Desillusionierung um. Das Gebrüll der Löwin erstickt im Rauschen des Ozeans.